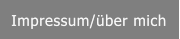Raketenflugplatz-Berlin
Raumschiffen und Raumstationen vorgelegt und durch
Formeln unternauert.
Im Januar 1924 schreibt Max Valier, der das Buch gelesen
hat, an den Verleger. Es beginnt eine Zusammenarbeit von
Oberth und Valier zur Verbreitung von Oberth's Theorien
und zum Sammeln von Geldern für Versuche.
In diesem Jahr erfährt Oberth auch von Konstantin E.
Ziolkowski. In der UdSSR war 1923 eine Notiz über "Die
Rakete zu den Planetenräumen" in den Zeitungen er-
schienen, darauf hatte man sich an Ziolkowski erinnert und
Kontakt zu Oberth aufgenommen.
Im August 1924 schlägt der Bankier Carl Barthel aus
Würzburg Oberth vor dessen Versuche zu finanzieren, er
wolle aber noch ein Gutachten abwarten. Das Gutachten
von Prof. Lorenz von der Hochschule Berlin-Charlottenburg
fällt negativ aus. Oberth sei "von falschen Voraussetzungen
ausgegangen." Darauf zieht
Barthel seine Zusage zur
Finanzierung von Oberth's Versuchen zurück.
Frau im Mond
Im Frühjahr 1928 schließt Oberth die Arbeiten zu seinem
neuen Buch "Wege zur Raumschiffahrt" ab.
Auf Einladung des bekannten Regisseurs Fritz Lang fährt er
im Juli 1928 nach Berlin um Gespräche zum Raketenfilm
"Frau im Mond" zu führen. Ein Vertrag zwischen der UfA und
Hermann Oberth wird im Juli geschlossen. Vereinbart wird
eine Beratertätigkeit für die wissenschaftliche Richtigkeit der
Raumfahrtszenen. Später kommt die Schaffung einer Höhen-
rakete für Werbezwecke zur Filmpremiere als Aufgabe dazu.
Im März 1929 wird das Patent Nr. 570511 zur Kegeldüse
eingereicht: "Vorrichtung zum Antrieb von Fahrzeugen durch
Rückstoß ausströmender Verbrennungsgase".
Nachdem er ab Sommer 1929 die Raketen-Szenen des
Stummfilms mit entwickelt hatte, nimmt Oberth vermutlich
Ende Juli erste Versuche für die praktische Umsetzung des
Flüssigkeitstriebwerkes auf. Erfolgreich führt er Vorversuche
durch, um Benzin und Flüssigsauerstoff zu mischen und zu
verbrennen. Beim Versuch größere Mengen Benzin in
Flüssigsauerstoff zu verbrennen kommt es dann zu einer
heftigen Explosion, bei der Oberth verletzt wird.
Schlosser der UfA-Werkstatt fertigen für Versuche eine
Version seiner Kegeldüse. Dieses Triebwerk brennt bei Tests
ohne Probleme. Den Körper der 2 m langen Rakete lässt
Oberth bei Drittfirmen auf eigene Kosten anfertigen.
Noch ist er überzeugt, die Rakete werde Mitte Oktober etwa
50 km Höhe erreichen.
Nachdem die Arbeiten zur Rakete immer mehr in Verzug
geraten und neue Schwierigkeiten auftauchen, wechselt
Oberth den Entwurf zur "Kohlenstabrakete". Diese
"einfache" Rakete mit Hybrid-Treibstoff (fester Kohlenstoff
und Flüssigsauerstoff) soll 10 m lang werden und das
Triebwerk aus Stabilitätsgründen am Kopfende haben. Auch
diese Konstruktion wird nicht fertiggestellt.
Zur Vorpremiere der "Frau im Mond" am 30. September
vor geladenen Gästen und Mitarbeitern wird Oberth auf die
Bühne gerufen und mit Beifall gefeiert. Oberth scheint noch
an die Verwirklichung der Höhenrakete zu glauben. Am 3.
Oktober sendet er deswegen ein Schreiben an das Reichs-
ministerium mit der Bitte um Erlaubnis zwischen dem 10.
und 20. Oktober an der Ostseeküste zwischen Horst und
Schleffin eine Proberakete starten zu dürfen. Die Premiere
der "Frau im Mond" findet jedoch ohne Raketenstart und
ohne Oberth's Anwesenheit am 15. Oktober in Berlin statt.
Nachdem der enttäuschte Oberth noch ein Patent
"Verfahren zur schnellen Verbrennung von Brennstoffen"
549222 angemeldet hat, regelt er mit seinem Assistenten
Rudolf Nebel das weitere Verfahren im Falle der unfertigen
UfA-Rakete. Ende Dezember 1929 reist Oberth schließlich
von Berlin nach Mediasch ab.
Peenemünde und die Kriegsjahre
Eine Einladung nach Berlin erreicht Oberth im April 1937. Er
wird zu Walter Dornberger, Wernher von Braun und anderen
geladen. Nach dem Gespräch wird im Dezember eine
Vereinbarung zwischen Oberth und der Deutschen
Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. in Braunschweig über eine
2-jährige Forschungstätigkeit geschlossen. Es gibt "keine
verbindlichen Forderungen" an Oberth. Bevor die zwei Jahre
um sind, geht Oberth Ende Juni 1938 auf Veranlassung der
DVL nach Wien an die Technische Hochschule. In Felixdorf
nahe Wien errichtet Oberth eine kleine Versuchsstation. Dort
feuern er und sein Mechaniker kleine Raketenmotoren für
Alkohol und Flüssigsauerstoff und führen Versuche mit
Feststofftreibstoffen durch.
Nach dem Besuch führender Peenemünder in Felixdorf
übersiedelt Oberth etwa im Juli 1940 mit seinem Mechaniker
an die TH Dresden. Kaum ein Jahr später bittet Oberth im Mai
1941 wegen bürokratischer Schwierigkeiten, nach Mediasch
zurückkehren zu dürfen. Dies wird ihm mit Hinweis auf die
Geheimhaltung verwehrt.
Als Ergebnis wird er aber Ende Juli 1941 nach Peenemünde
dienstverpflichtet. Oberth schreibt dort eine Arbeit "Über die
beste Teilung von Stufenaggregaten" und begutachtet
ausländische Patente.
Hermann Oberth - Vater der Raumfahrt
Hermann Oberth wurde am 25. Juni 1894 in Hermannstadt,
Siebenbürgen geborgen. Sein Vater ist der Chirurg Dr. Julius
Gotthold Oberth, seine Mutter Valerie Oberth (geb. Krasser).
Sein jüngerer Bruder Adolf fällt im Ersten Weltkrieg.
Nach der Lektüre von Jules Verne's "Von der Erde zum
Mond" ist der 12-jährige Hermann fasziniert von der Idee zum
Mond zu fliegen. Er experimentiert um die Effekte und die
menschlichen Reaktionen auf Schwerelosigkeit,
Beschleunigung oder Druck zu erforschen.
Mit bestandenem Abitur zieht er im Herbst 1913 nach
München um dort Medizin zu studieren.
Nach Ausbruch des Krieges wird Oberth in Siebenbürgen
gemustert. An der Ostfront verwundet, wird er danach als
Sanitäter eingesetzt. Während dieser Zeit erarbeitet er 1917
den Vorschlag für eine Flüssigwasserstoff/-sauerstoff-Rakete.
Mit 25 m Höhe und einer Nutzlast von 10 to soll sie 300 km
weit fliegen. Sein Vorschlag wird vom deutschen Militär
abgelehnt. Kurz vor Kriegsende heiratet er am 6. Juli 1918
Mathilde Hummel.
Die Rakete zu den Planetenräumen
Im Februar 1919 erfolgt die Immatrikulation in Physik an der
Universität Klausenburg, zum nächsten Semester wechselt
Oberth nach München. Als im November Ausländer Bayern
verlassen müssen, geht Oberth nach Göttingen. Seinen
Entwurf einer dreistufigen Weltraumrakete schließt er dort im
Sommer 1920 ab. Im nächsten Frühjahr übersiedelt Oberth
mit Frau und Sohn Julius nach Heidelberg. Dort erfährt
Oberth erstmals von Robert H. Goddard und tritt mit ihm in
einen lockeren Schriftwechsel ein. Oberth stellt seine
Berechnungen zur Raumfahrt im Herbst 1921 fertig und
reicht die Schrift als Dissertation ein.
Doch Niemand sieht sich als für das gewählte Thema
zuständig an. Die Arbeit wird abgelehnt. Enttäuscht verlässt
Oberth Deutschland und zieht nach Siebenbürgen zu seiner
Frau und den zwei Kindern. An der Universität Klausenburg
schließt Oberth darauf ein Lehrerstudium mit seiner
abgelehnten Dissertation als Abschlussarbeit ab.
Seine Arbeit erscheint nun im Verlag Oldenbourg im Juni
1923 als Buch "Die Rakete zu den Planetenräumen". Die
Herstellung muss Oberth selbst bezahlen. In diesem Buch
wird erstmals ein komplexes System von Höhenraketen,




Oben: Oberth’s Entwurf der Mondrakete und die Umsetzung in “Frau im Mond”.
Rechts: Die Kegeldüse, von der in der UfA Filmwerkstatt Testversionen gebaut und erprobt werden.




Oben: Oberth mit dem “Brenntopf” mit dem er die Verbrennung in Flüssig-Sauerstoff erprobt und vor der UfA-Werkstatt.
Rechts: Die Form der zweiten “vereinfachten” UfA-Rakete hat Oberth im Buch “Wege zur Raumschiffahrt” angedeutet.
Anfang 1943 erfolgt die Versetzung zum Windkanal in
Peenemünde, dort wird er mit einfachen Auswertungs-
arbeiten beschäftigt.
Im Dezember 1943 wird Oberth schließlich zur Arbeit
nach Reinsdorf bei Wittenberg verlegt. Er forscht bei der
Sprengstoff AG WASAG an Feststoffraketen. Auf Basis
seines Feststoff-Raketen-Entwurfs von Mediasch soll eine
Flugabwehrrakete mit Steuerung durch schwenkbare
Düsen entwickelt werden. Auch der Entwurf einer
Feststoff-Interkontinentalrakete von 11000 km Reichweite
wird dort durchgeführt.
Oberth stellt 1944 während der Arbeit bei der WASAG
auch sein neues grundlegendes Buch über die Raumfahrt
fertig. Das 1300 Seiten starke Typoskript geht jedoch in
den Wirren des Krieges verloren.
Das Kriegsende erlebt Hermann Oberth in einem süd-
bayerischen Dorf. Er wird von den Amerikanern interniert.
Währenddessen entwirft er eine interkontinentale "Post-
rakete" mit Flügeln und mit zwei seitlichen Feststoff-
Boostern und 11500 km Reichweite. Ursprünglich als
"Empfehlung" für seine Verwendung bei den Amerikanern
gedacht, behält Oberth den Entwurf jedoch für sich.

Am 23. Juli 1930 auf dem Hof der “Chemisch-Technischen Reichsanstalt” Berlin mit der UfA-Rakete.
Von links: Rudolf Nebel, Dr. Franz Hermann Ritter, Hans Beermüller, Kurt Heinisch, unbekannt, Hermann Oberth, Helmut Zoike,
Klaus Riedel (mit Mirak), Wernher von Braun, unbekannt. Das Foto machte Rolf Engel.
Schweiz, Italien, USA und zurück nach Deutschland
Im August 1945 wird Oberth entlassen und geht zu seiner
Familie nach Feucht. Dort hatte er 1943 ein Haus gekauft.
Er ist arbeitslos und schlägt sich als Gärtner und mit kleiner
Landwirtschaft im eigenen Garten durch.
Eine erste Anstellung findet er 1948 in der Schweiz beim
Eidgenössischen Militärdepartment in Bern für ein Jahr als
Gutachter und Berater. Danach arbeitet er ein Jahr lang bei
einer Feuerwerksfabrik in Oberried am Brienzer See.
Oberth unterschreibt danach Ende Mai 1950 einen
Vertrag mit der italienischen Marine und geht nach La
Spezia um dort seine Ammoniumnitrat-Rakete weiter zu
entwickeln. Bevor Oberth jedoch seine Arbeit in Italien
abschließen kann, entscheidet die italienische Regierung
anfangs 1953, amerikanische Raketen zu erwerben.
Oberth zieht darauf zurück nach Feucht und arbeitet an
seinem neuen Buch "Menschen im Weltraum - Neue
Projekte für Raketen und Raumfahrt", welches 1954
erscheint.
Die amerikanische Weltraumbehörde ruft ihn im Mai 1955 in
die USA. Oberth arbeitete in Huntsville in der von Dr. Ernst
Stuhlinger geleiteten Abteilung für Zukunftsstudien. Schon
Ende 1958 erfolgt jedoch die Rückkehr nach Feucht. Im
November 1961 wird Oberth noch einmal in die USA
gerufen. Die Firma Convair in San Diego verpflichtet ihn für
9 Monate als Berater.
Danach geht Hermann Oberth endlich in den Ruhestand.
Er beschäftigt sich jetzt hauptsächlich mit metaphysischen
Pro-blemen und umweltfreundlicher Energieerzeugung.
Beim Start von Apollo 11 am 21. Juli 1969 ist Oberth
Ehren-gast. Sein Traum vom Flug zum Mond wird noch zu
seinen Lebzeiten Wirklichkeit.
1971 eröffnet in Feucht das "Hermann Oberth Museum"
und widmet sich der Erforschung und Verbreitung des
Werkes des großen Forschers.
Hermann Oberth stirbt in der Nacht des 28. Dezembers
1989 in einem Krankenhaus in Nürnberg.
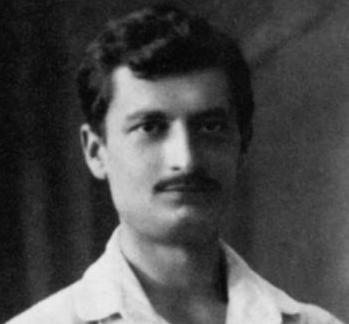
Hermann Oberth in den USA während der Tätigkeit im Redstone Arsenal mit James J. Fagan, General Holger Toftoy (mit Nike
Flugabwehrrakete) und, ganz rechts, Dr. Ernst Stuhlinger.
Der hier vorgestellte Lebenslauf soll nur ein kurzer Abriss
des kreativen Schaffens von Hermann Oberth sein. Mit
seinem Leben und Werk befasst sich das Museum in Feucht
in wissenschaftlich herausragender Form.
Wer nähere Informationen zum Vater der Raumfahrt sucht,
ist hier genau richtig:


![Tabellarischer Lebenslauf Oberth [PDF]](index_htm_files/757.png)

Rudolf
Nebel






Im Jahr 1926 beginnt Oberth in Mediasch im kleinen
Rahmen selbst mit praktischen Versuchen. Die Lehrwerkstatt
des Gymnasiums, an dem er lehrt, fertigt für ihn Verbren-
nungsgeräte für hauptsächlich gasförmige Betriebsstoffe. Mit
wasserverdünntem Alkohol /gasförmigem Sauerstoff erreicht
er eine Ausströmgeschwindigkeit von 3400m/sec; mit
gasförmigem H2/gasförmigem O2 sogar 4200 m/sec.
1927 erhält Oberth einen Brief eines Oberschülers namens
Wernher von Braun: "Ich weiß, dass Sie an die Zukunft der
Rakete glauben. Das tue ich auch, und daher erlaube ich
mir, Ihnen als Anlage eine kleine Untersuchung vorzulegen,
die ich gemacht habe …"
Oberth antwortet: "Machen Sie nur weiter so, junger Mann!
Wenn Sie das Interesse beibehalten, kann aus Ihnen etwas
werden."
Verein für Raumschiffahrt
Die Gründung des "Verein für Raumschiffahrt" VfR erfolgt in
Breslau am 5. Juli 1927, dieser soll alle Raumfahrtforscher
zusammenbringen. Johannes Winkler wird Vorsitzender, Max
Valier, dem man diesen Posten angetragen hatte, lehnt
wegen seiner Vortragsverpflichtungen ab. Hermann Oberth
tritt dem VfR im August bei und wird am 15. November
schließlich in den Vorstand gewählt.
Auf Einladung des VfR hält Oberth dann im Mai 1928 einen
Vortrag an der TH Breslau vor etwa 200 Zuhörern. Anfang
Juni 1928 kommt es in Zoppot bei Danzig zum Zusammen-
treffen von Oberth und Prof. Lorenz, der mit seinem nega-
tiven Gutachten die Finanzierung von Oberth's Versuchen
verhindert hatte. Es ist die Jahresversammlung der
"Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt". In der
Diskussion muss Geheimrat Prof. Dr. Konrad Lorenz sein
Fehlurteil eingestehen.
Eine Urkunde von der Reichsanstalt
Im Mai 1930 erhält Oberth Nachricht von Nebel aus Berlin.
Die renommierte Chemisch-Technische Reichsanstalt hat
sich bereit erklärt, Versuche mit den Raketendüsen zu begut-
achten. Oberth solle nach Berlin zurückkehren. Außerdem
werde im Herzen Berlins die "Luftfahrtwoche" durchgeführt,
dabei könne sich Oberth mit seinem Raketenprojekt präsen-
tieren. Auf der kleinen Raketenausstellung im Kaufhaus
Wertheim am Alexanderplatz steht dann neben Oberth auch
der 18-jährige Wernher von Braun und erklärt den Besuchern
die Ausstellungsstücke.
An der Chemisch-Technischen Reichsanstalt findet am 19.
und 23. Juli 1930 die Vorführung von Flammtopf, Spaltdüse
und Kegeldüse vor Pressevertretern statt. Der Leiter, Dr.
Ritter, stellt ein Gutachten über den erfolgreichen Betrieb aus.
Es ist dies die erste Urkunde weltweit über den erfolgreichen
Betrieb eines Flüssigkeitstriebwerk.
Ende Juli kehrt Oberth nach Mediasch zurück. Er selbst
sagt: "Zwei Jahre war ich zu nichts mehr imstande" (in der
Raketenforschung), er beschäftigt sich mit metaphysischen
Problemen. Währenddessen eröffnet sein ehemaliger
Assistent Rudolf Nebel am 27. September in Nord-Berlin den
"Raketenflugplatz Berlin" als Versuchsstelle. Oberth wird in
die Arbeiten dort nicht eingebunden.
Seit November 1927 im Vorstand des VfR, legt Oberth aus
Verärgerung über das Informations- und Finanzgebaren des
Vereins am 10. April 1931 sein Amt nieder und tritt aus dem
VfR aus.
Oberth wird Ende April 1932 zu einer Audienz beim
rumänischen König Carol II geladen. Seine Majestät weist
die militärische Flugschule in Mediasch an, Oberth bei
seinen Versuchen zu unterstützen. Dieser beginnt mit dem
Entwurf einer Höhenrakete und Forschungen zu Pump-
einrichtungen. In einem Brief vom April 1933 beschreibt
Oberth seine Mediasch-Versuchsrakete als 1400 mm lang
und mit einem größten Durchmesser von 142 mm. Die
Rakete wird durch Benzin und Flüssigluft angetrieben, die
Treibstoffe werden durch einen Gasgenerator druckge-
fördert. Wenn erfolgreich, soll die eigentliche Rakete eine
Länge von 15 m bei einem Durchmesser von 200 mm
erhalten. Sie erinnert an den zweiten Entwurf zur UfA-
Rakete, auch hier sitzt das Triebwerk am Kopf. Nachdem
der Bau der Versuchsrakete im Sommer 1934 abgeschlos-
sen ist dauert es mangels Treibstoff bis zum Start noch etwa
ein Jahr.
Währenddessen entwirft Oberth eine funkgesteuerte Fest-
stoffrakete zur Verwendung als Höhenforschungs- oder
Flakrakete. Er entwickelt dazu eine gießbare Treibstoff-
masse unter Verwendung von Ammoniumnitrat.