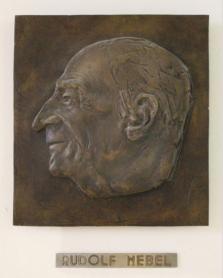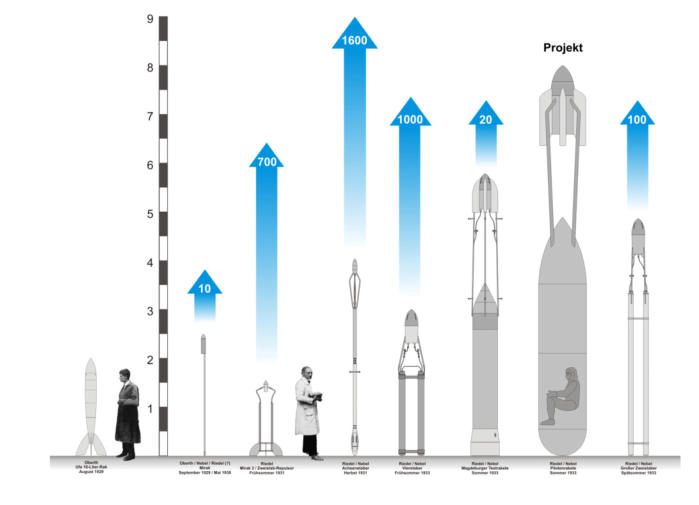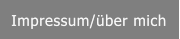Raketenflugplatz-Berlin
Oberth kehrte nach diesem Fehlschlag frustriert in seine
Heimat Rumänien zurück. Sein Helfer bei der UfA, Rudolf
Nebel, organisierte einen Termin bei der Chemisch-
Technischen Reichsanstalt. Dort wurde kontrolliert Oberths
Raketentriebwerk “Kegeldüse” getestet und ein amtliches
Gutachten ausgestellt. Berliner Raumfahrtenthusiasten
erwarben darauf das Triebwerk und die UfA-Rakete und
mieteten ein brachliegendes Militärgelände im Norden
Berlins an. Dort, auf dem “Raketenflugplatz Berlin” wurde
1930 bis 1934 mit primitiven Mittel ein recht erfolgreiches
privates Versuchsprogramm durchgeführt.
Raketen, Triebwerke und Flugkörper:
Die Arbeiten des Raketenflugplatz Berlin
Hermann Oberth war 1929 vom Regisseur Fritz Lang als Berater
für seinen Weltraumfilm “Frau im Mond” nach Potsdam
Babelsberg geholt worden. Oberth machte Lang die Idee
schmackhaft, als Werbung für die Filmpremiere eine richtige
Flüssigkeitsrakete zu starten und damit einen neuen
Höhenweltrekord aufzustellen.
Oberth führte in den Filmwerkstätten der UfA erste
systematische Versuche zu Verbrennung von Benzin und
Flüssigsauerstoff durch. Doch die gebaute Rakete erwies sich als
nicht flugfähig. Die Filmpremiere wurde Ende 1929 auch ohne
Raketenstart ein großer Erfolg.
Zeitgenössische
Zeichnung des
Versuchsgeländes am
Tegeler Weg in Berlin.


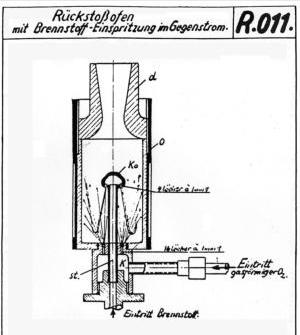



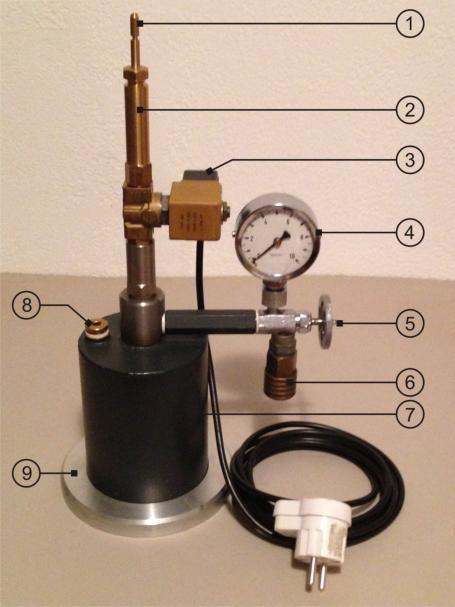

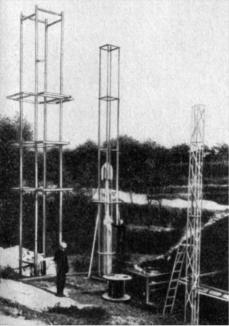
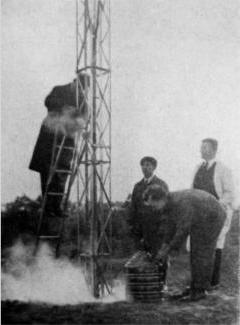




Die Büro-Baracke auf
dem Raketenflugplatz.
Die erste geflogene Rakete des Raketenflugplatz Berlin war die von
Rudolf Nebel konzipierte Minimum-Rakete “Mirak”. Unter Einsatz
von möglichst wenig Material und Treibstoff sollten erste
Erfahrungen mit dem Start von Raketen erworben werden. Nach
der Treibstoffkapazität wurde die Rakete auch “Ein-Liter-Rakete”
genannt.
Rechts: Schnitt durch die Mirak. Die Kegeldüse von Oberth liegt zur
Kühlung im Sauerstofftank. Der den Feuerwerksraketen
nachempfundene lange Führungsstab diente als Benzintank.
Pressetermin auf dem Raketenflugplatz Ende 1930. Im Startgestell mit
der Leiter steht die Mirak. Dahinter das von Oberth entworfene
Startgestell mit der UfA-Rakete und einer Attrappe rechts.
Die Personen von links: Riedel, Nebel, Heinisch,
Engel, verdeckt vermutlich von Braun und dann
Beermüller.
Grundlagenforschung wurde zuerst mit Oberths
Kegeldüse, dann mit selbst entworfenen
Triebwerken durchgeführt. Ein besonderes Problem
war die Kühlung der Triebwerke. Hier ist der
Kühlmantel durchgebrannt.
Rechts: Klaus Riedel 1931 mit der von ihm
entworfenen Mirak 2, auch “Repulsor” genannt. Die
Rakete flog im Mai 1931 etwa 60 Meter hoch.
Nachfolger schafften etwa 700 Meter Flughöhe.
Oberths Startgestell wurde zu einem Teststand
für Triebwerke umfunktioniert. Die Steuerung
der Zündung und der Treibstoffzuführ wurde
über Seilzüge von einem nahen Gebäude aus
durchgeführt.
Die erfolgreichste Rakete der Arbeitsgruppe am
Tegeler Weg war der “Achsenstaber”. Wie alle
Entwürfe des Raketenflugplatzes war die Rakete
als Kopfbrenner ausgelegt. Das Triebwerk befand
sich an der Spitze und zog die Rakete hinter sich
her. Dies sollte auch ohne aktive Steuerung einen
senkrechten Aufstieg gewährleisten.

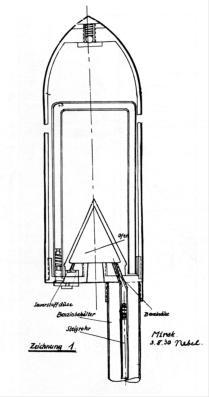
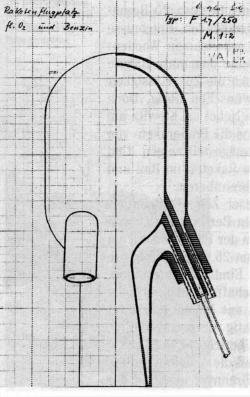


Gruppenfpoto nach den erfolgreichen Tests des Oberth’schen Flammtopfes und der Spalt-
und der Kegeldüse an der Chemisch-Technischen Reichsanstalt Berlin am 23. Juli 1930.
Von Links: Rudolf Nebel, Dr. Franz Ritter, Hans Beermüller, Kurt Heinisch, unbekannt,
Hermann Oberth, Helmut Zoike, Klaus Riedel, Wernher von Braun, unbekannt.
Oberths Kegeldüse war
das erste Triebwerk,
welches auf dem
Raketenflugplatz gezündet
wurde.
Der Achsenstaber ereichte Flughöhen bis 1600
Meter und landet am Fallschirm. Rudolf Nebel
sprach aber gegenüber dem Heereswaffenamt
von Flughöhen bis 4000 Meter. Die zuverlässige
Rakete konnte mehrfach verwendet werden.
Der Achsenstaber weckte die
Aufmerksamkeit des Heeres-
waffenamtes. Die Vorführung
eines Achsenstabers vor Militärs
in Kummersdorf schlug jedoch fehl
und das Heer wollte die Kosten
nicht übernehmen.
Der daraus entstehende Streit
zwischen Rudolf Nebel und dem
Heer brachte Wernher von Braun,
der schlichten wollte, mit dem
Heereswaffenamt ins Gespräch.
Das Heer stellte ihn schließlich als
Werkstudenten an.
Geschnittenes Triebwerks des Achsenstabers für
25 kp aus einem Filmbericht der damaligen Zeit.
Nach dem Achsenstaber machte man sich auf dem
Raketenflugplatz daran, die Schubleistung auf das
zehnfache zu steigern. Hier wird ein Triebwerk der
Klasse 200 bis 250 kp getestet.

Die Anordnung des Teststandes mit den vier
Tanks und dem Triebwerk wurde kurzerhand in
eine flugfähige Version übernommen und flog
dann 1933 als “Vierstaber”.
Die Stadt Magdeburg stellte dem Raketenflugplatz Geld zur Verfügung, um dort den
ersten Start einer bemannten Rakete durchzuführen. Mit einem 750 bis 1000 kp-
Triebwerk sollte eine Rakete 1000 Meter Höhe erreichen und der im unten im
stromlinienförmigen Körper sitzende “Pilot” Kurt Heinisch sollte dann mit dem
Fallschirm abspringen. Weder Triebwerk noch Rakete waren zum versprochenen
Starttermin fertig.
Ein Vierstaber wurde so umgebaut, dass er der bemannten Rakete ähnelte und
nach Magdeburg gebracht. Hier wurde den Geldgebern erzählt, man müsse vor Ort
zuerst die Schwerkraftlinien testen. Der Start am 29.Juni 1933 schlug dann fehl.
Teile des Magdeburger Vierstabers wurden zu einer neuen Rakete
umgebaut, die auf dem Schwielowsee nahe Berlins gestartet
wurde. Die Rakete flog am 9. August 1933 nur wenige Meter hoch
und konnte aus dem Wasser geborgen werden.
Bei einem erneuten Flug am 11. September 1933 erreichte sie 80
bis 100 Meter Höhe und versank dann im See.
Trotz vieler Fehlschläge bei den Flugversuchen
ging die Entwicklung von Triebwerken in Berlin
weiter. Hier zeigt Hans Beermüller ein Triebwerk
welches 400 bis 600 kp leisten sollte.
Die Raketen vom Raketenflugplatz Berlin 1930 bis 1933

Die Triebwerke vom Raketenflugplatz Berlin 1930 bis 1933
LOX = Flüssigsauerstoff (Liquid Oxygen)
Einige Triebwerke wurden auch mit der Kombination Alkohol-Wasser/LOX erprobt.
Zum Vergrößern klicken. Die Zahlen geben die maximal erreichte Flughöhe in Metern an.
Rege Versuchstätigkeit in Berlin
Mitarbeiter auf dem Raketenflugplatz Berlin war der junge
Willy Ley (1906 - 1969), der sich selbst als Chronisten der
Raketen- entwicklung sah. Er wanderte 1935 in die USA
aus und wurde dort Autor bedeutender Raumfahrtbücher.
In “Rockets - The Future of Travel beyond the
Atmosphere” von 1944 schildert er auch die Ereignisse auf
dem Berliner Raketenflugplatz. Besonderen Wert erhält
dieser Bericht, weil Ley nicht nur Zeuge der Arbeiten in
Berlin war, sondern auch etliche Notizen mit in die USA
genommen hat. Die Gestapo beschlagnahmte später alle
Unterlagen des Raketenflugplatz - sie sind leider
verschollen. In seinem Buch wird übrigens der Name
Wernher von Braun erstmals öffentlich erwähnt.
So berichtet er von den unterschiedlichen Versionen, die
von den einzelnen Raketentypen gebaut wurden. Die
Arbeiten verliefen nicht geplant systematisch, aber in
Serien, die eine stete Weiterentwicklung beinhalteten.
Triebwerke und Raketen wurden in Stückzahlen von
teilweise einem Dutzend gebaut. Dies steht im
Gegensatz zu den gleichzeitig arbeitenden Forschern
Robert H. Goddard in den USA und Johannes Winkler,
der in Berlin ebenfalls in einer anderen Ecke des
Raketenflugplatzes wirkte.
Für das Jahr zwischen dem ersten Flug des Repulsors
im Mai 1931 bis Mai 1932 hat sich Ley 270 Brenntests
und 87 Raketenstarts notiert.