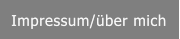Raketenflugplatz-Berlin
Museum:
Museum Kummersdorf
Südlich Berlins liegt das große Areal der ehemaligen Heeres-
Versuchsanstalt Kummersdorf. Seit der Kaiserzeit wurden hier
Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstungen für das Heer
untersucht und an Verbesserungen geforscht. Besonders
bekannt sind die Raketenversuche mit flüssigen Treibstoffen,
die seit 1932 durch Dr. Kurt Wahmke und Wernher von Braun
mit einer kleinen Gruppe von Technikern und Studenten
durchgeführt wurden. Die Grundlagen, die in Kummersdorf
geschaffen wurden, führten zu den großen Raketen von
Peenemünde und von dort zur Raumfahrt.
Im Kasino der Heeresanstalt fantasierten die jungen Raketen-
Enthusiasten von der Raumfahrt. 1936 hielt Wernher von
Braun 1936 im Kummersdorfer Kasino im kleinen Kreis von

Militärs und Forschern Vorträge über eine bemannte
Raumstation und über einen Flug zum Mond.
Heute ist der Förderverein des Museums tatkräftig dabei, die
Erinnerung an die Heeresanstalt zu erhalten, die Geschichte
ausfzuarbeiten und die wenigen erhaltenen Fundstücke den
Besuchern zugänglich zu machen.
Dabei sind neben der Ausstellung im Museum noch die im
Gelände vorhandenen ehemaligen Versuchsbunker der
Raketenpioniere wichtige Zeitzeugen der Versuchstätigkeit
zwischen 1932 bis 1945. Diese Versuchsstände liegen heute
in einem Sperrgebiet, können jedoch teilweise in geführten
Touren in Begleitung von Museumsmitarbeitern besichtigt
werden.
Diese Fundstücke vom Gelände sind verschiedene
Ausströmdüsen für Feststoff-Raketen, die in Kummersdorf für
Artilleriezwecke entwickelt wurden. Die schräggestellten
Dieses detaillierte Modell im Museum zeigt den großen
Prüfstand 4, in dem die erste große Rakete der deutschen
Raketenentwicklung, das Aggregat A3, senkrecht erprobt
wurde.
Dieses Modell zeigt die Anlage rund um den großen
Prüfbunker Nummer 5 in Kummerdorf mit dem großen
Bunkerbau links und den wohl älteren Prüfständen vorne.
Eine Sammlung von Strahlrudern und ein Panzerfenster aus
einem Prüfstand. In das vorderste Ruder für das Aggregat 5
ist das Datum 24.5.38 eingeritzt.
Oben: Diese durchgebrannte Versuchsdüse aus Aluminium
gehörte zu einem Triebwerk mit 300 kp Schub und
Wasserkühlung (2W). Dahinter liegt ein Versuchsstück für ein
nicht identifiziertes Triebwerk.











Ausströmdüsen sorgen dafür, dass die Geschosse rotieren
und so stabil fliegen.
In der Mitte, die Aufhängung für die Rakete aus massiven
Stahlträgern. Rechts und links davon sind durch die
kreisbogenförmigen Gleise verbunden,die beiden
Montagehallen gelegen.




So sieht die oben im Modell gezeigte Anlage heute im
Gelände aus. Vom Innenraum eines der Prüfstände sind die
Sehschlitze in den Betonmauern zu erkennen.Vermutlich
waren die Beobachtungsstände damals überdacht. Im
Hintergrund befindet sich der große Bunker.
Restaurierungs-Spezialist Klaus Schlingmann gibt den
Maßstab für einen Nachbau des Aggregat A2 ab. Dies war
die erste erfolgreich in Kummersdorf entwickelte und 1934
auf Borkum geflogene Flüssigkeitsrakete. Den Nachbau
fertigte Dr. Olaf Przybilski aus Dresden an.


Ein Aggregat A3 im Prüfstand 4. Alle vier Startversuche im
Dezember 1937 auf der Ostseeinsel Greifswalder Oie
schlugen wegen zu träger Kreisel fehl.